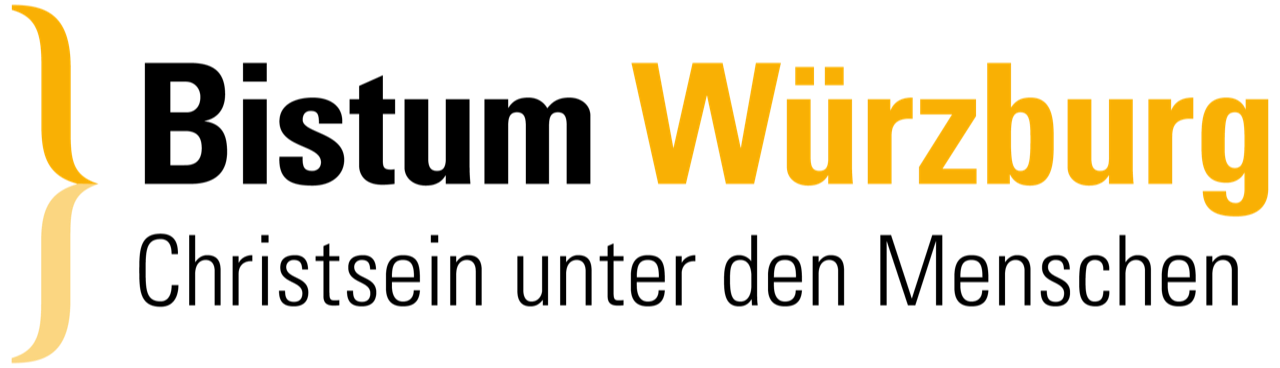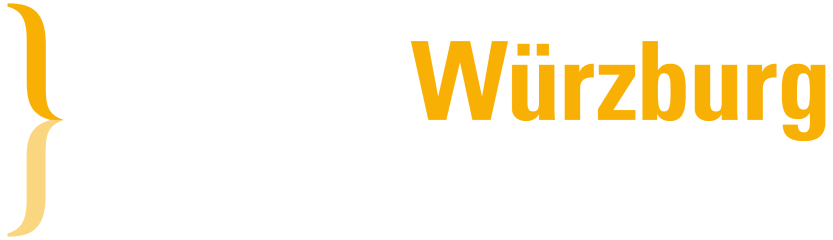Adresse
Pfarrkirche St. Sebastian, Kirchberg 10, 96179 Rattelsdorf
Kleiner Führer durch die Pfarrkirche St. Sebastian und unser Dorf Mürsbach
Liebe Besucher unserer Pfarrkirche St. Sebastian!
Die Pfarrgemeinde St. Sebastian Mürsbach heißt Sie in unserer Pfarrkirche, die seit vier Jahrhunderten Versammlungsraum, der katholischen Gemeinde und Ort der Gegenwart Gottes ist, herzlich willkommen. Dieser kleiner Führer möchte Ihnen helfen, sich in unserer Kirche und ihrer Geschichte zurechtzufinden und einige Besonderheiten unseres Dorfes zu entdecken.
Zunächst einige Informationen zur Geschichte der Pfarrei
Im Jahr 802 wird der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Mürsbach gehörte kirchlich ursprünglich als Filiale zu Altenbanz. Das Datum der Errichtung als selbstständige Pfarrei ist unbekannt, die erste urkundliche Erwähnung eines Pfarrers fällt in das Jahr 1316. Flächenmäßig konnte die Pfarrei als eine Großpfarrei gelten, da sie sich nach Osten fast bis in das Maintal erstreckte. Durch die Neugliederung der bayerischen Bistümer im Jahr 1816 kamen diese Ortschaften zum Erzbistum Bamberg. Die Pfarrei Mürsbach mit ihren 1000 Katholiken umfaßt heute 14 Ortschaften und gehört zum Dekanat Ebern des Bistums Würzburg.
Das Gebäude unserer Pfarrkirche
Turm und Chorraum der heutigen Kirche gehen in das 15. Jahrhundert zurück, es bestanden aber Vorgängerbauten, die bis in das 13. Jahrhundert zurückreichen dürften. Über die Bauzeit dieser ersten Kirche ist aber nichts Sicheres überliefert. Das heutige Langhaus wurde unter Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn im Jahr 1613 erbaut, der Chorraum umgestaltet. Das Wappen dieses Würzburger Bischofs, der nach den Wirren der Reformation sein Fürstbistum religiös und organisatorisch erneuert hat, ziert als Schlußstein das gotische Rippengewölbe im Chorraum. Bischof Julius Echter dokumentierte oft und gerne die Stabilisierung des katholischen Glaubens mit dem Bau einer neuen Kirche.
Die Ausstattung der Kirche
Aus der Zeit Julius Echters stammen auch die Grabdenkmäler, die Sie in der Kirche, vor allem im Chorraum, sehen, ebenso an der Friedhofsmauer, die einst als Wehrmauer gedient hat. Die Grabplatten bzw. Epitaphien gehörten Mitgliedern des fränkischen Adelsgeschlechts "derer von Fulbach", die ihren Sitz in Gleusdorf und das Recht der Grablege in der Mürsbacher Kirche hatten.
Das Epitaph des letzten Fulbach, Christoffel von Fulbach, finden Sie an der linken Seite des Chorraumes. Er starb 1565. Vielleicht finden Sie unter den zahlreichen Adelswappen, die auf den Grabdenkmälern die "blaublütige" Verwandtschaft des Verstorbenen anzeigten, das Wappen der Fulbachs heraus! Das Epitaph des bereits oben erwähnten Christoffel von Fulbach zieren von links die Wappen derer von Rotenhan, Fulbach, Herbilstadt und Steinau.
Die Altäre und der Patron unserer Kirche
Die Altaraufbauten stammen von Georg Götz aus Bamberg (1692), die Bilder von Sebastian Reinhard/Bamberg. Das Altarblatt des Hauptaltars zeigt das Martyrium des hl. Sebastian, des Patrons unserer Kirche. Als Offizier in der römischen Prätorianergarde hatte er sich gegen die Terrormaßnahmen des Kaisers Diokletian in der Christenverfolgung um das Jahr 303 gestellt. Verurteilt zum Tod durch Pfeilbeschuss, wurde der Schwerverletzte durch Christen gesund gepflegt. Kaum genesen, beschuldigte Sebastian erneut den Kaiser wegen seiner Verbrechen. Daraufhin ließ ihn Diokletian erschlagen. Sebastian ist damit ein Vorbild der Gewissenstreue und Standhaftigkeit aus dem christlichen Glauben heraus. Er zeigte, dass menschliche Herrscher dort Grenzen ihrer Macht haben, wo andere unter dieser Macht leiden. Die Verehrung des Hl. Sebastian blühte vor allem auch deshalb auf, weil er als Helfer im Gebet bei Pestepidemien angerufen wurde. Die Pest wurde wie Pfeile im Mittelalter bis in das 17. Jahrhundert hinein vom Volk empfunden, da es unter dieser Seuche schrecklich zu leiden hatte.
Die Figuren am Hauptaltar zeigen den Hl. Petrus (links) und den Hl. Paulus (rechts). Beide haben, jeder auf seine Weise, das Evangelium vom Auferstandenen verkündigt und zählen damit auch zum Fundament der Kirche, Darüber stehen links der HI. Urban und rechts der Hl. Nikolaus. Urban als Patron der Winzer und die von Weinranken umkränzten Säulen des Altars weisen darauf hin, dass an den Hängen am Ortsende von Mürsbach in Richtung Gleusdorf einst Wein angebaut wurde. Die Terrassen sind heute noch im Gelände zu erkennen. Den Abschluss des Hochaltars bildet der Erzengel Michael mit der Seelenwaage. In Verbindung mit dem Bild des Christus Salvator (=Retter) wird hiermit der Gemeinde vor Augen geführt, dass Christus die Welt am Ende der Tage richten und endgültig von allem Leid und allem Bösen erlösen wird.
Der Marienaltar zeigt die Muttergottes als Himmelskönigin, darüber beugt sich Gottvater segnend über die Weltkugel. Das Gegenstück auf der linken Seite bildet der Kreuzaltar (1694), darüber das Bild der Schmerzhaften Muttergottes:" Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen" (Lk2,35b).
Deckengemälde im Jugendstil
Eine letzte Epoche, die unsere Pfarrkirche prägte, war der Jugendstil. Unter der Leitung des Regierungsbaumeisters und späteren Universitätsprofessors Fritz Fuchsenberger wurde im Jahr 1910 eine der interessantesten Kirchenrenovierungen in der Diözese Würzburg durchgeführt. Noch heute kündet davon das Deckengemälde von den Münchner Malern Pius Ferdinand Messerschmitt und Carl von Marr. Es zeigt die Übergabe des Rosenkranzes an den HI. Dominikus. Wahrscheinlich wurde dieses Motiv gewählt, weil die weltliche Kirchweihfeier nahe dem Rosenkranzfest im Oktober begangen wird. Prunkstücke der Jugendstilausstattung waren die Beichtstühle aus amerikanischen Nussbaumholz. Die Emailledarstellungen der Gründer bzw. Erstmissionare in den bayerischen Bistümern dürfen als Hinweis für die Gläubigen verstanden werden, dass der Weg zur Heiligkeit über die persönliche Umkehr führt und das Sakrament der Versöhnung der Kirche anvertraut ist.
Die Bemalung der Wände und der Emporenfelder wurde in einer »Nacht- und Nebel-Renovierung" im Jahr 1939 zerstört, doch entsprechen die einfachen weißen Wände dem Bedürfnis unserer Zeit nach Klarheit, Ruhe und Licht.
Als Höhepunkt einer erneuten Renovierung im Jahre 2002 weihte unser damaliger Würzburger Bischof Prof. Dr. Paul-Werner Scheele den neuen Ambo als Ort der Verkündigung und den Steinaltar als Symbol für Christus, den Grundstein seiner Kirche und unseres Lebens.
Noch einige Hinweise für den Gang durch das Dorf
Der Kirchplatz mit Friedhof wurde im 15. Jahrhundert in den Religionswirren befestigt. Das Wehrtürmchen, Reste der Mauern und das Pfarrhaus sind aus dieser Zeit erhalten. Auf dem Kirchplatz, der als einer der bedeutensten Sandsteinplätze Frankens gilt (19. Jahrh.), steht die ehemalige Schule, ein Gebäude aus dem 17./18. Jahrhundert. Das Pfarrhaus neben der Kirche reicht bis in das 16. Jahrhundert zurück und war in die Verteidigungsanlage als Turm oder Vorratsgebäude einbezogen. Im Jahr 1733 wurde es barockisiert und auf die doppelte Länge gebracht. Nach der Renovierung von 1988/89 beherbergt das Gebäude neben dem Pfarrhaus einen Pfarrsaal und ein Jugendheim in den ehemaligen Stallungen. Im Pfarrhof finden Sie ein barockes Bienenhaus um das Jahr 1750. Es ist eines der wenigen erhaltenen barocken Kleingebäude Bayerns.
Am Fuß des Kirchbergs steht eine Brunnenanlage aus dem 18. Jahrhundert; der älteste Dorfbrunnen war jedoch beim heutigen Dorfplatz, der "Sutte", wo sich auch ein kleiner Dorfweiher befand, der vom heute verrohrten Mürsbach gespeist wurde.
Die Verkündhalle, im Volksmund "Lindenhäusla", ist ein Stück Rechtsgeschichte aus dem 18. Jahrhundert. Hier fanden öffentliche Gerichtsverhandlungen statt, ebenso wurden hier die gemeindlichen Vorordnungen bekanntgemacht. Sie finden die Verkündhalle neben der Hauptstraße.
Das Dorfbild von Mürsbach prägen die Fachwerkbauten des 16. bis 18. Jahrhunderts mit ihrem reichen Zierfachwerk.
Die Dreifaltigkeitskapelle am südöstlichen Ortsrand in Richtung Zaugendorf entstand im 16. Jahrhundert. Rechts neben der Eingangstür ist das eingemeißelte Wappen von Fürstbischof Julius Echter zu erkennen. Bei Wallfahrtsgottesdiensten wurde der steinerne Freialtar, geschaffen von Sebastian Degler (1716/17), an der Südwestseite der Kapelle genutzt. Er zeigt die heiligste Dreifaltigkeit.
Wir wünschen Ihnen beim Verweilen in unserer Kirche und beim Spaziergang durch das Dorf viel Freude und gute Erholung.